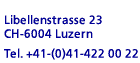
| Zurück | |
Home > Projekte > Publikationen > Artikel und Beiträge > LEGO Willisau |
Ganzer Artikel in Druckversion inkl. Bilder und Schemas (pdf, 497 kB)
Energieverbundsystem im LEGO-Fabrikationsgebäde in Willisau
Von Markus Dolder, Kriens
und Josef Felchlin, Emmenbrücke
Die LEGO Gruppe erwartet innerhalb der Spielzeugbranche ein erhöhtes Wachstum. Konkurrenzdruck und der Kampf um Marktanteile werden härter. Diese Situation verlangt grosse Flexibilität, um noch rascher auf veränderte Kundenbedürfnisse und Konkurrenzsituationen reagieren zu können. Das neue Fabrikations- und Lagergebäude in Willisau mit seinem zukunftsweisenden Konzept leistet einen Beitrag, dass diesen Anforderungen Rechnung getragen werden. Das als Konzept vom dänischen Architektbüro Rudolf Lolk entworfene Gebäude hat einen modularen Aufbau. Es besteht aus sechs Modulen (ca. 58 X 58m mit zwei Geschossen), die mit Zwischenbauten verbunden sind. In einer weiteren Ausbauphase ist geplant, zwei zusätzliche Module anzufügen.
Flexibilität ist gefordert
Die geforderte Flexibilität, die unterschiedlichen Nutzungen und
Ausbauphasen sowie auch die Versorgungssicherheit haben einen entscheidenden
Einfluss auf die Konzepte der Haustechnikanlagen. Die LEGO Produktion
AG beauftragte das Ingenieurbüro Künzle + Partner AG Kriens-Luzern
im Herbst 1990 mit dem Energiekonzept und der Planung; der gesamten HLK-Anlagen.
Der Auftrag umfasste die Projekt- und Ausführungsplanung inkl. Bauleitung
der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen der Schalttafeln
(HLK-Anlagen),
der DDC-Regulierung
und des Gebäudeleitsystemes HLK.
Bereits im Oktober 1993 wurden die ersten Module für die weltweite
Produktion der DUPLO Produkte durch die LEGO Produktion AG bezogen. Die
Realisierung dieses Bauwerkes mit einer Gesamtbausumme von 165 Millionen
Franken war nur möglich durch eine straffe Gesamtprojektleitung und
die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten des Planungsteams. Die kompetente
und entscheidungsfreudige Bauherrschaft legte zu Beginn mit einem Phasenplan
der verschiedenen Ausbauphasen die Grundlage für die Auslegung der
Haustechnikanlagen fest. Für die Wärme- und Kälteversorgung
musste also eine Infrastruktur geschaffen werden, die in der Lage ist,
mit einem minimalen Energieaufwand und einer optimalen Betriebsweise,
die unterschiedlichen Nutzungen und Phasen abzudekken. Dies konnte auf
der Versorgungsseite dadurch erreicht werden, dass für jedes Modul
eine eigene Versorgungszentrale geschaffen wurde, die das Gebäude
mit Wärme für die Raumheizung, Lufterwärmung, Brauchwassererwärmung
mit Kälte für die Prozesskühlung zur Produkteherstellung
und Kühlung der Produktionsräume sowie mit Luft für die
minimal erforderliche Aussenluftmenge und zum Abführen von Wärme
aus den Produktionsräumen versorgt. In jede der fünf Versorgungszentralen
sind drei Medien geführt:
- Niedertemperaturwärme 50/ 40°C für die Raumheizung, Brauchwarrnwasservorwärmung und Lufterwärmung.
- Mitteltemperaturwärme 65/ 55°C für die Brauchwarmwassernachwärmung
- Kälte 6/12 °C für die Prozesskühlung und die Luftkühlung
Die gewählten Medientemperaturen erlauben eine Nutzung von Abwärme auf ihren jeweiligen Temperaturniveau. Neben anderen Voraussetzungen ist dadurch die Grundlage für ein effizientes Energieverbundsystem geschaffen.
Wärmeenergie wird verschoben
Das Ziel eines Energieverbund- Systems ist es, Energie (im vorliegenden
Falle Wärmeenergie) an Orten, wo ein Überschuss davon vorhanden
ist, zu entziehen, um diese in anderen Gebäudeteilen, wo ein Energiebedarf
besteht, zu nutzen. Je nach Lastverhältnissen und Wärmeenergiebedarf
kann im vorliegenden Gebäude die Wärme an folgenden Stellen
entzogen werden:
- Kühlen der Formen (Produktionsprozess
der LEG0 Teile) - Wärmeentzug auf den Fabrikationshallen
- Wärmeentzug aus Technikräumen (Trafostation, Drucklufterzeugung, EDV-Raum)
Eine Kühlung dieser Räume ist aus Prozess- oder anlagetechnischen
Gründen notwendig. Über den Wärmepumpenprozess ist es nun
möglich, diese Wärme zu nutzen. Zusätzlich wird direkte
Abwärme aus der Druckluftproduktion auf dem Mitteltemperaturniveau
genutzt. Die Nutzung der Abwärme ist einer jahreszeitlichen Schwankung
unterworfen. Im Sommer, wenn die Wärme nur teilweise gebraucht werden
kann, muss der Überschuss abgeführt werden. Dazu wird der Kühleffekt
durch Verdunstung in Kühltürmen zu Hilfe genommen. Das Kühlwasser
zwischen den Kältemaschinenkondensatoren und den Verdunstungskühlern
zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf. Das Wasser, das zur Verdunstungskühlung
genutzt wird, ist gesammeltes Regenwasser von den ca. 20'000 m2 grossen
Dachflächen. Dieses wird in einen 1'100 Kubikmeter grossen Tank geleitet,
der gleichzeitig als Retentionsbecken dient. In Trockenperioden speist
eine eigene Grundwasserfassung zusätzlich den Tank.
Umweltfreundliche Kälteerzeugung mit gutem
Wirkungsgrad
Am auffälligsten in der Energiezentrale sind die beiden York-Wärmepumpen/
Kältemaschinen, das Herz des Energieverbundsystems. Um den variierenden
Lastverhältnissen Rechnung zu tragen und auch im Teillastbetrieb
mit guten Wirkungsgraden zu fahren, sind für die Kompressionsarbeit
Schraubenverdichter eingesetzt. Als Kältemittel wurde Ammoniak gewählt.
Dieses wird seit über hundert Jahren erfolgreich für diese Anwendung
eingesetzt und erlebt zurzeit eine Art Renaissance. Ammoniak hat hervorragende
thermodynamische Eigenschaften, kein Ozonabbaupotential, kein Treibhauspotential
und ist biologisch abbaubar. Die York-Aggregate
werden doppelt genutzt, sowohl für die Wärme- als auch für
die Kälteproduktion. Auf der Verflüssigerseite sind drei Wärmetauscher
hintereinander geschaltet. Zuerst durchströmt das Heissgas den Enthitzer,
dann den Wärmerückgewinnungskondensator und zuletzt den Kondensator
zur Abführung der Wärme an den Verdunstungskühler. Der
Olkühler der Kältemaschine
ist ebenfalls in die Abwärmenutzung eingebunden.
Lüftungsanlagen für Energiegewinnung
Die Lüftungsanlagen sind wichtige Bestandteile des Energieverbund-
Systemes. Wie auch die Wärme- und Kältegewinnung sind sie auf
das Gesamtkonzept abgestimmt. Die Lüftungsgeräte sind in den
Zwischenbauten plaziert. Durch mächtige Rohre wird die Zuluft
in die Fabrikations- und Lagerräume geführt. Über Quelluftauslässe
strömt die Luft mit leichter Untertemperatur aus und gelangt in Form
eines Frischluftsees zu den Personen. Überall, wo sich im Raum Wärmequellen
befinden (Menschen, Maschinen), entsteht ein Konvektionsluftstrom. Die
erwärmte Luft steigt zur Decke und wird durch Abluft
Öffnungen abgesaugt. Durch dieses Lüftungssystem verringert
sich der Energiebedarf bei der Kühlung, und es hat gegenüber
anderen Systemen einen besseren Lüftungswirkungsgrad. Aus der warmen
Abluft
kann nun Energie entzogen werden. Entweder direkt über die im Gerät
eingebaute Wärmerückgewinnung oder zusätzlich bei Bedarf
über Wärmeentzug mittels Luftkühler und Nutzung über
das Energieverbundsystem. Im Modul 1 (Infrastrukturgebäude) sorgen
kleinere Lüftungsanlagen für gute Luft, unter anderem in der
Cafeteria, der Küche und den Büros. Die Anlagen sind so geschaltet,
dass beim Öffnen der Bürofenster der entsprechende Luftstrang
automatisch abgeschaltet wird.
Kleine Module regulieren grosse Module
Den Kopf des Energieverbundes bildet eine Landis & Gyr-Regulierung
in DDC-Technik (Digital Direct Control). Ausgewählte Messstellen
fragen den Anlagezustand ab und ermöglichen es so, über einfache
hydraulische Schaltungen und einfache Regelfunktionen in einem Teil des
Gebäudes Wärme zu entziehen und an andere Gebäudeteile,
wo diese Wärme genutzt werden kann, abzugeben. Gesamthaft ergibt
sich ein recht komplexes vernetztes System. Es wurde jedoch darauf geachtet,
dass die einzelnen Systeme autonom funktionsfähig und nur wenige
Schnittstellen vorhanden sind. Dies wurde erreicht durch einen modularen
Aufbau der Systeme und eine jederzeit verfügbaren Handbedienebene.
Auch die Schalttafeln und Elektro- Schemas sind modular aufgebaut. Bei
einem späteren Ausbau oder Umbau, der durch eine Umnutzung nötig
wird, können die erforderlichen Schalttafelfelder ähnlich wie
bei den LEGO Steinen modular angebaut werden.
Ein durchgedachtes und konsequent bis ins letzte Detail durchgezogenes
Beschriftungs- und Bezeichnungssystem ermöglicht dem Betriebspersonal
eine rationelle Wartung aller Anlagen und Systeme. Die Grundlagen und
Voraussetzungen dazu mussten schon sehr früh in der Planungsphase
geschaffen werden.
Modernste Computersysteme sparen Energie- und
lnstandhaltungskosten
Eine weitere Unterstützung für die rationelle Bedienung aller
Anlagen gibt das Gebäudeleitsystem. Auf Monitoren sind die Zustände
auf einen Blick ersichtlich. Auf Protokolldruckern erscheinen aktuelle
Meldungen der Anlagen oder Wartungshinweise. Die Bedienung erfolgt auf
einer gewohnten Benutzeroberfläche mit Fenstertechnik (0S2). Für
Auswertungen und Optimierungen steht dem Betreiber ein ausgeklügeltes
Messkonzept zur Verfügung. Mit dessen Hilfe ist es der LEGO Produktion
AG möglich, die Energieflüsse im Gebäude zu kontrollieren
und Energiebilanzen zu erstellen. Dadurch kann eine Aussage gemacht werden,
wo wieviel Energie verbraucht, umgewandelt oder produziert wird. Die Überwachung
und Darstellung der Wirkungsgrade, Laufzeitenund Betriebsweisen der Aggregate
und Anlagen spart Energie- und Instandhaltungskosten. Über eine eigens
für dieses Objekt geschaffene Schnittstelle werden die anfallenden
Daten in ein Tabellenkalkulationsprogramm übernommen. Damit ist eine
für den Anlagebetreuer sehr aussagekräftige Darstellung in Diagrammen
und Grafiken möglich, und die Bedienung erfolgt wiederum auf einer
vertrauten Benutzeroberfläche.
Kurze lnstallationszeit
lnstallationsbeginn im Rohbau war der 1. Februar 1992. Am 1. Oktober hatte
die LEGO Produktion AG ein fixfertiges und beheiztes Modul bezogen. Die
letzten Gebäudeteile wurden am 1. Februar 1993 ebenfalls termingerecht
an die Bauherrschaft übergeben. Die Realisierung dieses Vorhabens
war nur möglich durch die straffe, jedoch sehr unkomplizierte Führung
des Generalunternehmens Alfred Müller AG und die entscheidungsfreudige
Bauherrschaft. Dadurch wurden gute Rahmenbedingungen und eine ausgezeichnete
Atmosphäre geschaffen. Ein weiteres Plus für die Realisierung
des Energieverbundsystemes war die Tatsache, dass die HLK-Anlagen
in der Planung, wie auch später nach der Vergabe in der Ausführung
aus einer Hand kamen. Dadurch ergaben sich keine Schnittstellenproblerne
und kurze Entscheidungswege. Die Anlagen Heizung, Lüftung, Klima,
Kälte, Regulierung und Leitsysteme konnten somit optimal aufeinander
abgestimmt werden.
Ganzer Artikel in Druckversion inkl. Bilder und Schemas (pdf, 497 kB)
| nach oben |
|
|
| Zurück | |
Home > Projekte > Publikationen > Artikel und Beiträge > LEGO Willisau |
Sitemap |
Suchen
Impressum | Datenschutz+Recht
![]()